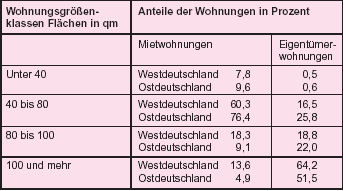|
||
| Refugien der Sicherheit | ||
| ||
|
Einblicke in den suburbanen Alltag Von Walther Jahn, Stephan Lanz, Ellen Bareis und Klaus Ronneberger Berlin ist eine Mieterstadt, doch nicht jeder Berliner ist ein Mieter. Und einige von denen, die es einmal waren, sind es heute schon lange nicht mehr. Ihrem Schicksal gilt in besonderer Weise die Sorge der Berliner Stadtentwicklungspolitik. Nein, von den Obdachlosen ist natürlich nicht die Rede, eher im Gegenteil von denen, die ein anderes Obdach gefunden haben, ein Eigenheim und das nicht einmal in Berlin, sondern im Umland. Für sie interessiert sich auch der nebenstehende Bericht. Dabei wird bewusst auf die Beschreibung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Situation der Interviewten verzichtet. Gefragt wird, wie es kommt, dass diejenigen, die in den 70er und 80er Jahren den neuen sozialen Bewegungen zuzurechnen waren, jetzt die Lebensmuster ihrer Eltern reproduzieren. Lebensformen, die sie als ausgeprägte Nonkonformisten, ursprünglich entschieden abgelehnt hatten Die Antwort, weil man von Nonkonformismus allein nicht leben kann, und weil man wie die Eltern eine tüchtige Portion Opportunismus braucht, um sich Eigenheim und nonkonformistischen Lebensstil, der inzwischen im Einkauf in kleinen schicken Boutiquen kulminiert, leisten zu können, wäre sicherlich ebenso richtig wie auch trivial. Angesichts der Klarheit und Entschiedenheit ihrer Motivation aber, und das macht der Bericht deutlich, erscheinen die Bemühungen der Herren Strieder und Stimmann um die "Urbaniten" einigermaßen naiv. Und nichts anderes hat das MieterEcho in der Diskussion um den Masterplan schon immer behauptet. "Wenn Ihr mich vor 10 Jahren gefragt hättet,... ... ob ich mal ins Umland ziehen will, hätte ich Euch für verrückt erklärt", erklärte eine unserer Interviewpartnerinnen und brachte damit die zentrale Frage am Beginn unserer Untersuchungen auf den Punkt. Wie kommt es, so überlegten wir, dass das Leben in Suburbia (engl.: Vorstadt) auch auf Leute eine ungebrochene Anziehungskraft auszustrahlen scheint, die zuvor mit der Konformität ihrer Elterngeneration gebrochen hatten. Gehört es nicht seit Jahrzehnten zu den Grundüberzeugungen der Linken und der feministischen Bewegung, dass das "Eigenheim im Grünen" die charakteristische Wohnform der patriarchalen Familie mit ihren geschlechtsspezifischen Rollenzuweisungen darstellt, dass Frauen allein schon durch die räumliche Struktur der Vororte zu einem isolierten Hausfrauendasein verdammt sind? Weit über die links-alternative Kreise hinaus gelten die suburbanen Reihenhaussiedlungen als der Inbegriff eines monotonen und spießigen Lebens. Was bedeutet in dieser Situation die zunächst aus persönlichen Erfahrungen resultierende Beobachtung, dass nicht wenige - meist im Verlauf der Familienbildungsphase - in das Umland ziehen, obwohl sie zuvor dem Vorstadtleben ablehnend gegenüberstanden? Bringt der Wohnsitzwechsel fast automatisch einen "Rückfall" in tradierte Modelle der Elterngeneration mit sich, oder entwickeln die Neuankömmlinge Strategien, die eine vollständige Anpassung an konventionelle Normen verhindern? Erweist sich Suburbia als eine räumliche Falle, die jegliche Form von "Andersartigkeit" tilgt, oder bestehen - allen Vorurteilen zum Trotz - auch dort Möglichkeiten, eigenständige Lebenskonzepte zu verfolgen? Diesen Fragen versuchten wir in der kleinen qualitativen Studie nachzugehen, für die wir 17 Leute im Alter zwischen 30 und 55 Jahren interviewten, die dem Umfeld der neuen sozialen Bewegungen in den 70er und 80er Jahren zugerechnet werden können. Zum Wohle des Kindes In der Frage nach dem Motiv für das Verlassen der Kernstadt in Richtung Suburbia sind sich alle Befragten einig: der Kinder wegen. Nach den Interviews bekommt man den Eindruck, als seien eine angemessene kindliche Lebensumwelt und die Stadt nicht miteinander vereinbar: Ohne Kinder, so der Grundtenor der Befragten, wäre die Innenstadt nach wie vor ihr bevorzugter Wohnstandort. Niemand scheint der Stadt überdrüssig. Im Bild von ihr überwiegt vielmehr das Positive: Kultur, Toleranz, soziale und ethnische Vielfalt, das bunte Leben auf die Straße prägen die Vorstellung vom urbanen Leben, an dem man eigentlich teilhaben will, der "Kleinen" wegen aber darauf verzichtet. Das Abwägen über das Für oder Wider eines Umzugs an den Stadtrand wirkt auf dieser Grundlage als rationale Kalkulation über Grenzkosten- und nutzen, deren Variablen sich mit der Gründung einer Familie drastisch verschieben. Während ausschließlich der Stadt positive Eigenschaften zugeschrieben werden, gilt Suburbia als Ort, der zwar keine eigenen Qualitäten aufweist, die urbanen Zumutungen jedoch aufhebt. Zum einen besteht die Hoffnung, ihre räumliche Struktur erleichtere die Elternarbeit: Während etwa Kleinkinder im eigenen Garten unbeaufsichtigt spielen können, müssen sie bei jedem Gang von der Etagenwohnung zum Spielplatz begleitet und beaufsichtigt werden. Zum anderen aber scheint nur Suburbia eine glückliche Kindheit zu garantieren. Die meisten Befragten scheinen fast automatisch davon auszugehen, dass Ruhe, naturnaher Freiraum und eine Abschirmung vor gesellschaftlichen Realitäten dafür unabdingbare Voraussetzungen sind. Lediglich eine Gesprächspartnerin verweist darauf, dass das an ihrem neuen Wohnort vorherrschende "spießige Gedankengut" auch Nachteile mit sich bringen kann: Ihre Tochter könne "jetzt zwar frei laufen, aber nicht mehr frei denken". Trotzdem lässt sie keinen Zweifel daran, dass sie beim Wechsel des Wohnortes das Wohl der Tochter im Auge hatte. Die Kinder sollen den üblichen Zumutungen urbanen Lebens nicht ausgesetzt werden. Ihre Angst vor "Drogenheinzen und Kinderfängern", überspitzt eine Interviewte ihre diffusen Ängste über das "Aggressionspotential der Stadt" ironisch, hätte sie nicht mehr losgelassen. Die Probleme der Stadt reichen so aus Elternsicht stets über Phänomene hinaus, die eine geringe Lebensqualität bewirken, wie Verkehr, Schmutz oder der Mangel an Grün. Vielmehr scheint hier der Mechanismus einer im Grunde konservativen Großstadt-Kritik zum Tragen zu kommen: In der prinzipiellen Lasterhaftigkeit des Metropolendschungels imaginiert man die Gefahr für die physische (Kinderfänger) und die psychische (Drogenheinze) Unversehrtheit der Kinder. Im Familienkontext verkehrt sich die zunächst positiv konnotierte urbane Vielfalt zur Belastung oder unberechenbaren Bedrohung, die durch "zunehmende Verrohung", die "ganzen Verrückten in der U-Bahn" oder gar aus dem Gefühl heraus entsteht, in der Innenstadt von "türkischen Mitbürgern umzingelt" zu sein. Angesichts solcher Aussagen stellt sich die Frage, ob die Verlagerung des Wohnortes lediglich das Ergebnis einer rationalen Kosten-Nutzen-Abwägung darstellt, bei der sich Suburbia als der effizienteste Raum für die Familie erweist. Es drängen sich darüber hinaus andere Vermutungen auf: Eine Gesprächspartnerin, die den Umzug in die Peripherie noch vor Geburt ihrer Kinder als unvorstellbar empfunden hatte, erzählt von ihrem Gefühl, dass man das "automatisch drin" habe, "mit der Familie an den Stadtrand zu ziehen". Es sei fast wie eine "Vorbestimmung". Es wirkt, als hätten die Stadtflüchtlinge psychische und soziopolitische Strukturen der Gesellschaft auf eine Weise verinnerlicht, die im Fall einer Familiengründung den Umzugswunsch in die Vororte gleichsam auslöst. Ursachen dafür liegen wohl nicht nur im überlieferten Bild einer Archetypik des Urbanen, wonach zur Stadt neben der Chance einer von überkommenen Normen und sozialer Kontrolle befreiten Selbstverwirklichung immer die Gefährlichkeit eines bedrohlichen Dschungels gehört. Vielmehr ist hier den sozialpsychischen Spuren einer Verknüpfung von Bevölkerungs- und Wohnungspolitik zu folgen, die in der Folge konservativer Großstadtkritik in den fünfziger Jahren zumindest in der Bundesrepublik das freistehende Einfamilienhaus zum Ideal erhob. Quer zu allen politischen Konstellationen wird seit dieser Zeit die symbolische Identität von Familie und Eigenheim durch die Ideologie und die Förderrichtlinien der Wohnungspolitik dominiert. Während den Konservativen die städtische Mietwohnung als verderblich für die familiäre Sittlichkeit galt, verstanden die Sozialdemokraten die suburbane Eigenheimförderung als effektive Strategie zur Versorgung "breiter Schichten des Volkes" mit Wohnraum. Wir und die Anderen Angesprochen auf die soziale Zusammensetzung der neuen Siedlung sind sich die Befragten einig: Hier wohnen "weder die ganz Armen noch die ganz Reichen, so Mittelschichten eben". Zu diesen zählen sie sich auch selbst. Weniger Ausbildung, Einkommen oder ethnische Zugehörigkeit markieren in der suburbanen Mittelstandsgesellschaft die soziale Trennlinie, sondern unterschiedliche Lebensentwürfe. Schon im Vorfeld war die Furcht vor den kleinbürgerlichen und spießigen Milieus in Suburbia ein zentrales Moment, den anvisierten Umzug mit Skepsis zu betrachten. Am neuen Ort angekommen, bestätigen sich zunächst vorherige Befürchtungen: die Nachbarn seien "spießig" mit ihrem "kleinbürgerlichen Fensterschmuck". Zu beklagen sind "Intoleranz" oder "Kulturlosigkeit": "Alles wirkt grau, ich fühle mich permanent overdressed", so eine Neu-Suburbanitin. Häufig entsteht mit wahrgenommener räumlicher Enge die Furcht vor sozialer Kontrolle. Es überwiegt das Gefühl, sich anpassen zu müssen, auffällige Kleidung nicht mehr anziehen zu können oder die Sorge davor, als Alleinerziehende fehl am Platze zu sein. Fragen etwa nach z.B. der Teilhabe am örtlichen Vereinsleben werden mit einem "soweit sind wir noch nicht gesunken" quittiert. Allerdings bestehen nur in einem Fall konkrete Konflikte mit den neuen Nachbarn. Diese scheinen primär als Projektionsfläche und Gegenbilder zum eigenen Lebensentwurf zu dienen: Wie sie möchte man auf keinen Fall enden. Bei genauerer Analyse erweisen sich die intensiven Abgrenzungsbemühungen als gezielter Versuch, den kindgerechten neuen Wohnort mit dem auf Selbstverwirklichung zielenden urbanistischen Lebensstil in Einklang zu bringen. Häufig versuchte man gemeinsam mit Freunden in eine Stadtrandsiedlung zu ziehen. Vor Ort angekommen wollen die meisten Befragten ein soziales Umfeld schaffen, das auf den eigenen Lebensstil zugeschnitten ist: Kontakte bauen sie in der Regel zu Leuten mit einer ähnlichen Biographie auf. Hierbei stellen die Kinder eine zentrale Ressource dar. Denn über sie ist es - etwa in Schulen und Kindergärten - möglich, Eltern mit ähnlichen Lebensstilen kennen zu lernen und sich so vom Zwang der sozialen Integration in die dominierenden kleinbürgerlichen Milieus zu lösen. Auf diese Weise bilden sich in Suburbia kleinere Lebensstil-Enklaven heraus, die vom dominierenden Milieu abgekoppelt sind. Dies relativiert die stets unterstellte Homogenität der Vororte. Trotzdem empfinden viele InterviewpartnerInnen dort die soziale Zusammensetzung als einen wesentlichen Mangel. Hierbei treten aber Widersprüchlichkeiten auf: "Ich will es gar nicht gefiltert, ich will es schon bunt, das ist aber nicht so einfach, man muss auch ehrlich sein. In Kreuzberg war es ja bunt, das darf sich ja jetzt auch nicht widersprechen", argumentiert etwa eine Gesprächspartnerin, der bewusst ist, dass die als negativ empfundenen Seiten sozialer Vielfalt schließlich einer der Gründe war, sich und dem Kind die Innenstadt nicht länger zumuten zu wollen. Erkennbar wird dies auch beim Thema Schule: Während die Qualität der innerstädtischen Schulen vor allem wegen der sozialen Zusammensetzung ihrer Schüler als wesentlicher Mangel angesehen wird, gilt dieses Problem mit dem Umzug als gelöst. Nicht zuletzt hierbei zeigt sich, dass die Suche nach einem gewissen Niveau von gesellschaftlicher Normalität ein wesentliches Moment des Umzuges darstellt: "Was in der Innenstadt zuviel an sozialer Mischung ist", so bringt es ein Gesprächspartner auf den Punkt, "ist hier zu wenig". Emergency-Exit Downtown Unsere InterviewpartnerInnen vermittelten nicht den Eindruck, als wollten sie sich in die Normalität der bürgerlichen Kleinfamilie zurückziehen. Der Umzug an den Stadtrand stellt somit grundsätzlich keine schlichte Regression auf den Pfad der Elterngeneration dar. Im Gegenteil - alle versuchen, tradierte Familienkonzepte zu unterlaufen. Insbesondere die Frauen entwickeln Strategien, um der Falle verräumlichter Rollenzuweisungen zu entgehen. Bei den kürzlich Zugezogenen spielt dabei der Bezug zur Innenstadt eine zentrale Rolle: Alle haben nach wie vor zentrale persönliche Kontakte zu Freunden, die in der Innenstadt leben. Überwiegend nutzt man diese Kontakte, um Suburbia - ohne Kinder - für Freizeitaktivitäten in der Innenstadt, also Kneipen-, Kino-, oder Theaterbesuche vorübergehend zu verlassen. In einer außerhalb der Siedlung gelegenen Arbeitsstelle liegt der andere wesentliche Außenbezug, der die räumliche und soziale Enge der Stadtrandsiedlung aufbricht: So beneidete etwa eine ältere Gesprächspartnerin, die ihr Gefühl von Eingeengtheit trotz ihrer Berufstätigkeit, die sie innerhalb der Wohnsiedlung ausübte, nicht los wurde, ihren Ehemann um seinen Arbeitsort in der Innenstadt. Nicht schon die Tatsache, dass man einer Erwerbsarbeit nachgeht, sondern vor allem deren Anbindung an die Kernstadt vermag die Reizlosigkeit Suburbias offenbar erst zu kompensieren. Interessant ist die Tatsache, dass weder die Entfernung noch die Verkehrsverbindung zur Innenstadt die Anbindung an sie maßgeblich zu beeinflussen scheinen. Bedeutsam ist vielmehr das dort verfügbare soziale Netz auf der einen und die Organisationsform der Familie auf der anderen Seite. Je offensiver die jeweiligen Paare eine von konventionellen Normen abweichende Familienbeziehung leben - mit geteilter Reproduktionsarbeit, getrennten Freundeskreisen und doppelter Erwerbsarbeit - desto selbstverständlicher wirkt das 'Switchen' zwischen Innenstadt und Wohnort, zwischen Familienleben und Außenbezügen. Hierbei zeigt sich, wie wenig sich die 'neuen Väter' der 68er-Generation aus dem klassischen Rollenverständnis heraus bewegt haben. Die Erziehung der Kinder geht eher zu Lasten der Frauen, die überwiegend nur dann ihren Beruf ausüben, wenn - wie etwa bei Lehrerinnen - Kindererziehung und Arbeitsalltag miteinander vereinbar sind. Dagegen deutet sich in den meisten Interviews mit den neuen - wohlgemerkt nonkonform orientierten - Suburbaniten eine geringere geschlechtsspezifische Differenz an. So überwiegen partnerschaftliche Modelle für Kinderbetreuung und Haushaltsführung, die eine innerfamiliäre Rollenverteilung in Abhängigkeit von Einkommen und beruflicher Situation der PartnerInnen phasenweise organisieren. Im Vergleich zum gesellschaftlichen Mainstream rücken dabei erstaunlich häufig die Frauen in die Position einer 'Haupternährerin'. Ungleich verteilt hingegen wirkt die Sorge darüber, die Außenbezüge - und dies bedeutet in allen Fällen: zur Innenstadt - nicht abreißen zu lassen. Während den interviewten Männern die Verfügbarkeit von Netzen und Kontakten außerhalb Suburbias als Selbstverständlichkeit erscheint, ist den Frauen die Gefahr bewusst, dass sich der suburbane Wohnort in eine räumliche Falle für ein emanzipatives Lebensmodell verwandeln kann, wenn die Innenstadtbezüge wegbrechen. Zwei Beispiele demonstrieren diese Gefahr: Beide Frauen gaben mit der Geburt des zweiten Kindes ihren qualifizierten Job auf, um sich für eine begrenzte Zeit Erziehungsaufgaben zu widmen. Sie rutschten daraufhin in die Rolle nicht nur der Haupterziehenden sondern auch der Hausfrau, während gleichzeitig ihre sozialen Kontakte außerhalb der Familie zunehmend brüchiger wurden. Obwohl die Männer nicht zu einer partnerschaftlichen Arbeitsteilung zu bewegen sind, versuchen beide, über die Wiederaufnahme einer Erwerbsarbeit der Isolation im Familienheim zu entkommen. Eine Frau scheiterte bislang am Versuch, einen qualifizierten Job zu finden, der sich mit der Kinderbetreuung verträgt. Die andere hingegen beginnt zum Zeitpunkt des Interviews eine ihrer Qualifikation nur bedingt entsprechende Halbtagsstelle auf Honorarbasis, für die sie mindestens zwei Stunden täglich pendeln wird. Durch die Restriktionen des Arbeitsmarktes wird hier die ohnehin prekäre Lage der beiden Frauen zusätzlich verschärft. Betreiben alle anderen jüngeren Neu-Suburbaniten ihre lokale Verwurzelung aufgrund der Priorität ihrer Außenbezüge zur Innenstadt relativ beiläufig oder lehnen lokale Vergemeinschaftungsformen sogar vehement ab, lässt sich bei diesen beiden Frauen beobachten, dass die Suche nach nachbarschaftlichen Beziehungen und gemeinschaftlichen Netzen innerhalb der Siedlung zum gleichsam existenziellen Bedürfnis gerät: Wünscht sich die eine Frau eine Siedlung mit eigenem Kindergarten, selbstorganisiertem Clubhaus und gleichgesinnten NachbarInnen, betont die andere ihre starke emotionale Bindung an das von ihren Großeltern geerbte Haus und die umgebende Siedlung. Die Interviews zeigen somit zwar, dass Suburbia sehr wohl ein familiäres Leben jenseits konventioneller Normen und geschlechtlicher Rollenzuweisungen ermöglicht. Allerdings kann sich die Stadtrandsiedlung durch ihre sozialräumliche Struktur nach wie vor in eine räumliche Falle verwandeln, wenn die Außenbezüge wegbrechen und der Versuch partnerschaftlicher Arbeitsteilung fehlschlägt: Und davon sind weiterhin hauptsächlich Frauen betroffen. Da sich die meisten unserer Interviewpartnerinnen dessen sehr wohl bewusst sind, versuchen sie Gegenstrategien zu entwickeln, um nicht in einer solchen Sackgasse "hängenzubleiben". Der Weg zurück Galt der Elterngeneration das suburbane Einfamilienhaus als Symbol sozialen Aufstiegs und materieller Sicherheit für den Lebensabend, sehen die meisten Befragten den Aufenthalt am Stadtrand als vorübergehende biographische Phase an. Da der Umzug nach Suburbia hauptsächlich "zum Wohle der Kinder" erfolgte, beabsichtigen sie, wieder in die Stadt zurückzuziehen, sobald diese das Haus verlassen haben. Hierfür ist nicht zuletzt die Form der Eigentumsbildung von Bedeutung: Ermöglicht etwa eine Erbschaft die Finanzierung des Eigenheims, spielt die eigentumsbedingte Bindung an den neuen Wohnort eine lediglich untergeordnete Rolle. Für jene HausbesitzerInnen hingegen, die mit der Finanzierung des Eigenheims die größten Belastungen eingegangen sind, rückt das Verlassen der Peripherie in die Ferne. Dass die Perspektive eines 'Suburbia auf Zeit' durchaus Relevanz für das Handeln besitzt, zeigt sich bei den Interviewten der 68er-Generation. Fast niemand möchte sich auf Dauer im vorstädtischen Leben einrichten. Vielmehr wird bei den meisten der Absprung entweder vorbereitet oder ist bereits vollzogen. Offen bleibt, für welches Modell sich die 1990er-Generation nach dem Auszug ihrer Kinder entscheiden wird: Der häufig formulierten Idee, dann wieder in die Innenstadt zurückzukehren, scheint die Idealvorstellung vieler Befragten von ihrem künftigen Wohnort zu widersprechen: Eine von einem großen Garten umgebene alte Villa, die zwar nahe zur Kernstadt, aber eben nicht in ihr liegen soll, symbolisiert hierbei das Wunschbild. Welchen Realitätsgehalt diese Imagination auch immer haben mag: es ist nicht unwahrscheinlich, dass mit dem suburbanen Familienalltag die Bindung zur Stadt mit der Zeit verloren geht und deshalb auch ein zukünftiges Interview mit einem "Wenn ihr mich vor zehn Jahren gefragt hättet..." beginnen könnte. Die ungekürzte Version dieses Textes erscheint in Kürze in der Zeitschrift "Widersprüche", Ausgabe "Fragmente städtischen Alltags", Dezember 2000, Kleine-Verlag. Pendlerbewegung von und nach Berlin Aus dem Mitte des Jahres veröffentlichten Pendlerbericht des Landesarbeitsamtes Berlin geht hervor, dass 70.000 Menschen aus der Region Berlin-Brandenburg regelmäßig nach Westdeutschland zur Arbeit fahren. Innerhalb eines Jahres ist dem Bericht zufolge die Zahl der Pendler um 9.600 angestiegen, das entspricht 16,4% mehr als im Vorjahr. Die Gesamtzahl setzt sich zu mehr als 60% aus Berlinern und zu rund 12% aus Cottbussern zusammen, die gemeinsam den größten Anteil der Pendler in die alten Bundesländer ausmachen. Aber auch zwischen den beiden benachbarten Bundesländern Berlin und Brandenburg herrscht reger Pendelverkehr:
Arbeitsamtbezirk (AB)
AB Potsdam
AB Eberswalde
AB Frankfurt (Oder)
AB Cottbuss
So wohnen Mieter und Eigentümer
| ||
| ||
| Startseite | MieterEcho Archiv | ||
|
© Berliner Mietergemeinschaft 2001 |